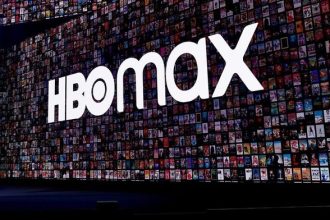Suchen
Copyright © 2025 Monrose.de. Alle Rechte sind geschützt.
Gesundheit
Michael Schanze nahm fast 100 Kilo ab – so ist ihm das gelungen
Michael Schanze hat rund 93 Kilo abgenommen. Im „Kölner Treff“ erklärt er offen, wie ihm dieser radikale Schritt gelungen ist.
Mehr von der Überschrift
- # Weitere Tags:
- Business Solution
- News
- Living
- Franchise
Herzinfarkt erklärt: Erste Anzeichen, Risiken und moderne Prävention
Ein Herzinfarkt kommt oft plötzlich. Dieser Artikel erklärt Symptome, Ursachen und wie man das Risiko gezielt senken kann.
Wie man den Blutdruck senken kann: wirksame Tipps für den Alltag
Praktische Tipps und Expertenmeinungen zum Senken des Blutdrucks im Alltag ohne unnötigen Stress.
Ernährung fürs Gehirn: Diese Lebensmittel stärken das Gedächtnis
Die richtige Ernährung spielt eine zentrale Rolle für Gedächtnis und Konzentration. Bestimmte Lebensmittel unterstützen das Gehirn besonders effektiv.
Welche Faktoren erhöhen das Krebsrisiko und wie man vorbeugen kann
Krebs entsteht meist durch mehrere Faktoren. Viele Risiken lassen sich durch bewusste Entscheidungen im Alltag deutlich reduzieren.